Unser menschlicher Stütz- und Bewegungsapparat ist eine HighTech-Konstruktion mit mehr als 100 Gelenken, 200 Knochen und etwa 650 Muskeln. Die Gelenke bilden eine bewegliche Verbindung zwischen verschiedenen Knochen, mit Zwischenscheiben, Membranen, Schleimbeuteln und wohl dosierter Gelenkschmiere. Die Muskeln liefern die Kraft zur Bewegung der Gelenke und starke Sehnen dienen der Kraftübertragung.
Das medizinische Fachgebiet der Orthopädie (der Begriff entstammt dem Altgriechischen und ist zusammengesetzt aus den Teilen orthos = richtig, aufrecht und paed = Kind) beschäftigt sich, ganz allgemein gesagt, mit dem Aufbau der menschlichen Knochen, Muskeln, Bänder und Gelenke sowie mit Fehlbildungen, Erkrankungen und Verletzungen dieses komplexen Bewegungssystems.
Medizinische Heilbehandlungen am Bewegungsapparat gibt es schon seit Anbeginn der menschlichen Zivilisation; unter Ausnutzung der Selbstheilungskräfte des Körpers werden schon in prähistorischer Zeit gebrochene Extremitäten wieder eingerichtet und geschient. Als Ursprung der „modernen“ Orthopädie gilt indes das Wirken des französischen Arztes und Literaten Nicolas Andry de Boisregard (1658-1742). Im Geiste der Aufklärung veröffentlicht Andry im Jahr 1741 ein Werk mit dem Titel „Orthopädie oder die Kunst bey den Kindern die Ungestaltheit des Leibes zu verhüten und zu verbessern (…)“. Andry sieht Deformationen von Knochen und Gelenken bei Kindern nicht mehr als gottgegeben und unveränderlich an; er hatte erkannt, dass während der kindlichen Wachstumsphase frühzeitiges Korrigieren von Fehlbildungen durch Schienen und Stützen zur Besserung des Erscheinungsbildes und der Funktionalität führt. Der Begriff Orthopädie war also gemeint im Sinne von aufrechtem Wachstum. Zur Veranschaulichung dieses Prinzips nimmt Andry das Bild des jungen Baumes, dessen krumm begonnenes Wachstum durch die Fixierung an einen starken Pfosten korrigiert wird. Diese Allegorie wird zum Symbol der Orthopädie weltweit.
Andrys Impulse werden von vielen Medizinern aufgenommen und umgesetzt. Um 1780 gründet Jean-André Venel in Orbe (Schweiz) ein erstes orthopädisches Institut, in das Kinder mit Fehlbildungen aufgenommen und mit Apparaten behandelt werden. Da die Korrektur Monate, oft auch Jahre erfordert, werden die jungen Patienten während des Aufenthaltes auch beschult. Venel nimmt am Beginn und zum Abschluss der Therapie Gipsabdrücke der verformten Knochen und kann damit seine Erfolge belegen.
Als Begründer der Orthopädie in Deutschland wird allgemein Johann Georg Heine (1771-1838) angesehen; er eröffnet 1816 im ehemaligen Stephanskloster zu Würzburg die erste orthopädische Anstalt; die Einrichtung wird unter dem Namen Karolinen-Institut, benannt nach der bayerischen Königin Karoline, international bekannt. Heine ist indes kein Mediziner sondern Mechaniker, der orthopädische Hilfsmittel herstellt und anwendet. Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Medizinern ist viele Jahre gedeihlich; zum Bruch kommt es, als Heine beginnt, auch andere Krankheitsbilder zu behandeln. 1828 siedelt er an die holländische Küste über und gründet dort eine „Orthopädische Seebadeanstalt“.
Im 19. Jahrhundert existiert lange noch keine gesetzliche Krankenversicherung, so dass es sich nur gutsituierte Familien leisten können, ein Kind, dem Verkrüppelung droht, zur langwierigen Behandlung in eine orthopädische Spezialklinik zu geben; die durchschnittliche Verweildauer beträgt zu dieser Zeit etwa zwei Jahre. Beschleunigt und verbilligt wird der Heilungsprozess ab etwa der Mitte des Jahrhunderts durch die sich weiter entwickelnde orthopädische Chirurgie, wo mittels der neuartigen Methoden zur Schmerzausschaltung (Betäubung mit Äther) sowie der Keimfernhaltung bei Operationen (Antisepsis) große Fortschritte erzielt werden. Um 1900 existieren in Deutschland bereits über 20 orthopädische Kliniken, darunter so berühmte Häuser wie das Berliner Oskar-Helene-Heim, das Friedrichsheim in Frankfurt/M. oder die staatliche orthopädische Klinik in München.
Ein Zeitsprung ins junge 20. Jahrhundert macht deutlich, wie sich der Tätigkeitsschwerpunkt in der Orthopädie verlagert: Im 1. Weltkrieg werden Millionen Soldaten verwundet und verstümmelt. Die Verbesserung der Beweglichkeit von Kriegsversehrten, idealerweise die Wiederherstellung ihrer Arbeitsfähigkeit steht nun im Mittelpunkt der orthopädischen Entwicklung. Der Zeitraum zwischen den beiden Weltkriegen erscheint aus heutiger Sicht zu kurz, um die Orthopädie entscheidend weiter zu entwickeln. Es zeichnet sich aber ab, dass eine weitere Verlagerung von der konservativen hin zu operativen Therapien (erste Arthroskopie, erste Versuche des Gelenk- und Knochenersatzes durch Fremdmaterialien) stattfindet. Während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft werden zahlreiche jüdische Spitzenmediziner aus Forschung, Lehre und Praxis ausgeschlossen, wodurch die medizinische Spitzenstellung Deutschlands nachhaltig geschwächt wird; ihre verkrüppelten Patienten werden als „lebensunwert“ gebrandmarkt und zwangssterilisiert, nicht wenige im so genannten Euthanasieprogramm ermordet.
Nach dem zweiten Weltkrieg ist es für deutsche Orthopäden zunächst mühevoll, wieder Anschluss an internationale Spitzenforschung und -Technologie zu finden. In den fünfziger und sechziger Jahren beginnt der Siegeszug der Implantologie mit Fremdmaterialien, gleichzeitig sehen wir wieder eine Verlagerung des Arbeitsschwerpunktes hin zur Traumatologie (Unfallchirurgie) als Folge des explodierenden Individualverkehrs. Als Konsequenz verschmelzen die Facharztausbildungen für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und in den letzten Dekaden rückt die Behandlung von Patienten mit altersbedingten (degenerativen) Leiden immer stärker in den Mittelpunkt der orthopädischen Praxis; manche sprechen gar schon von einer „Orthogeriatrie“. Doch wie schon seit frühester Zeit gilt nach wie vor als Ziel aller orthopädischen Behandlungen, die volle, normale Funktionalität des menschlichen Bewegungsapparates zu erhalten oder aber so gut als möglich wieder herzustellen.
Text: Alexander Strauch







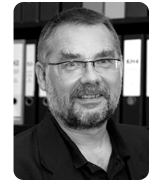
Hallo alle zusammen.
Ein orthopädischer Eingriff ist nicht immer leicht.
Eine Zweitmeinung Orthopädische Chirurgie sollte immer eingeholt werden.
So kann man sich sicher sein, dass der Eingriff der richtige ist.
Mein Onkel wurde nach der Zweitmeinung operiert und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Hier ein Link dazu: http://www.ordination-dorn.at/
VG Liam