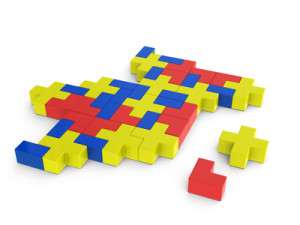
© squadcsplayer - Fotolia.com
Ein Dauerthema im Gesundheitssektor: Die Meldungen der Krankenkassen über ständig steigende Zahlen für behandlungsbedürftige, berufsbedingte Burnout-Fälle und Depressionen. Längst sind nicht mehr nur strebsame Manager betroffen – auch Studenten und sogar schon Schüler klagen vermehrt über derartige Symptome.
Dies sei kein Wunder, sagt Gerald Hüther, Professor für präventive Hirnforschung an der Universität Göttingen. Der Wissenschaftler hat seine Erkenntnisse in einem neuen Buch gebündelt: „Was wir sind und was wir sein könnten“ (S. Fischer Verlag, Frankfurt/M.) Danach bedienen sich die Strukturen im Arbeitsleben und die Art, wie in der Schule Wissen vermittelt werde, immer noch veralteter Muster aus dem letzten Jahrhundert, dem Maschinen-Zeitalter. Zur damaligen Zeit, so Hüther, brauchte die Gesellschaft vor allem „funktionierende“ Menschen, welche die ihnen übertragenen Aufgaben kontinuierlich und zuverlässig erledigten (mit teilweise fatalen Folgen, d.Red.) Auch der heute noch gebräuchliche Intelligenztest zur Ermittlung eines IQ wurde zu dieser Zeit entwickelt und ziele vor allem darauf ab, herauszufinden, wie zuverlässig ein Individuum „funktionieren“ wird.
Der Gegenwart jedoch, dem 21. Jahrhundert mit seinen immer komplexer werdenden Problemstellungen und Anforderungen, werde diese überkommene Arbeitsmethodik und auch die in den meisten Schulen und Hochschulen noch anzutreffende Art der Wissensanhäufung durch Eintrichtern und auswendig lernen nicht mehr gerecht, sagt Hüther. Er verweist auf Albert Einstein, der schon zu seiner Zeit zu der Erkenntnis gelangt sei, dass man die Probleme der Welt nicht mit denselben Mustern lösen könne, mit denen man sie erzeugt habe. Besonders traurig sei hierbei, dass bei der im Lern- und Arbeitsprozess vorherrschenden Monotonie nur ein kleiner Teil der möglichen menschlichen Gehirnleistung aktiviert werde. Dabei habe die Hirnforschung längst heraus gefunden, dass es weitaus bessere, effektivere Wege der Wissensvermittlung und Arbeitsorganisation gebe: Leistungsdruck und Stress müssten zurück gedrängt werden, um Raum für Kreativität und Begeisterung zu schaffen, so der Professor.

© contrastwerkstatt - Fotolia.com
Das menschliche Hirn sei kein Ablageort für möglichst viel Wissen, da seien Bibliotheken und das Internet viel besser geeignet. Laut Hüther müsse das Hirn vorrangig dazu benutzt werden, um mit dem verfügbaren Wissen kreativ umzugehen und es richtig zu vernetzen. Denn wenn jemand eine Aufgabe mit Interesse und Begeisterung angehe, würden -auch in reiferen Jahren des Erwachsenseins- tiefer liegende Nervenareale des Gehirns dazu angeregt, neue Verknüpfungen zu bilden, die letztlich neue Ideen und Erkenntnisse ermöglichten, so Hüther weiter. Der „Dünger“ für diese erweiterten Hirnaktivitäten sei eigenes Interesse und echte Begeisterung für ein Thema und keinesfalls Leistungsdruck und Stress. In diesem Zusammenhang kritisiert der Professor auch das von vielen engagierten Eltern forcierte frühkindliche Lernen mit zahllosen Angeboten: Kinder, die dauernd etwas angeboten bekommen, lernten vielleicht, viel zu konsumieren; ihre eigene Neugier, Entdeckungsfreude und Kreativität würden auf diesem Weg jedoch nur unzureichend gefördert.
Hirnforscher Hüther plädiert weiter dafür, das Prinzip der Motivation zur Entfaltung des ganzen individuellen Potentials konsequent in Schulen und Universitäten anzuwenden. Der heutige „Einser-Abiturient“, der im nahtlosen Anschluss wohlmöglich noch ein Einser-Studium absolviert, sei zwar ein angepasster Wissenssammler, aber gleichzeitig ein den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht werdendes Auslaufmodell, sagt er und verweist auf zahlreiche interessante Lebensläufe erfolgreicher Menschen, die zu ihrer Zeit Studien- oder sogar Schulabbrecher waren – aber eben jene gesunde Neugier und Kreativität hatten, das Unerhörte zu denken, Regeln zu brechen und neue Wege zu gehen. Lehr- und Führungskräfte müssten sich also vom „Eintrichterer“ und Befehlsgeber zum Impulsgeber und Motivator wandeln.


 Liebe Besucher,
Liebe Besucher,